Karl Knopf
Klang und Technik
Teil 3: Miss Marple jagt den Klirr

Reiner H. Nitschke VerlagsGmbH
Dem französischen Mathematiker und Physiker (1768-1830) ist eine wichtige Erkenntnis zu verdanken: Jede periodische Schwingung, Rechteck, Dreieck oder sonst eine periodisch wiederkehrende Form, lässt sich durch eine Summe von Sinusschwingungen darstellen. Deren Frequenzen sind ganzzahlige Vielfache der bestehenden Grundfrequenz. Das gilt auch für die verzerrte Sinusschwingung am Ausgang eines Verstärkers: Sie enthält Oberwellen („Harmonische“) bei der doppelten, dreifachen etc. Frequenz.
Im letzten Teil hatten wir festgestellt, dass Verstärker mit sehr wenig Gegenkopplung dazu neigen, muffig zu klingen, da der Hochton ohne Korrektur gemeinhin weniger verstärkt wird als der Tieftonbereich. Stellte man die Gegenkopplung nun so ein, dass der Frequenzgang ohne Einbrüche deutlich über die 40- kHz-Marke hinausgeht, sollten folglich keine Unterschiede zwischen Ein- und Ausgangssignal mehr wahrnehmbar sein. Denn es ist für unser Gehör nach heutigem Erkenntnisstand irrelevant, ob ein Verstärker bis 60 kHz oder bis 100 kHz linear verstärkt, da Veränderungen in diesem Bereich jenseits der Hörgrenze liegen. Die Realität besagt jedoch das Gegenteil.
Es ist inzwischen audiophiles Allgemeingut, dass Röhrenwie auch verschiedenste Transistorverstärker bei gleichermaßen linearen Frequenzgängen sehr unterschiedlich klingen. Auch unser zu Testzwecken gehörtes Verstärkermodul unterstrich diese Tatsache nach eingehendem Hörvergleich noch mal.
Dies allerdings bei Veränderungen nur eines einzigen Parameters, nämlich der Gegenkopplung:
- Schwache Gegenkopplung: vollmundiger Klang, Solostimmen erscheinen groß, Bass etwas weich, weitläufige aber etwas unpräzise Abbildung.
- Mittlere Gegenkopplung: kraftvolle, aber präzise Stimmwiedergabe, Bass knackig und mit Tiefgang, Räumlichkeit bei Orchestereinspielungen groß aber noch gut abgegrenzt.
- Hohe Gegenkopplung: Stimmen sehr direkt, etwas schlank, Bass sehr knackig aber wenig Tiefgang, Orchesteraufnahmen wirken präzise aber etwas dünn.
Interessant ist, dass das Transistormodul sich in seinen klanglichen Eigenschaften bei Verringerung der Gegenkopplung mehr und mehr dem Klang eines Röhrenverstärkers annäherte. Es muss folglich ein Kriterium geben, in welchem sich Röhren- und Transistorverstärker mit geringer Gegenkopplung ähneln, das gleichwohl aber auch für gewisse Unterschiede verantwortlich ist.
Wie suchen, wenn man nicht weiß wonach?
Dies ist die Frage, die sich in jedem Kriminalroman stellt. Schon in dem Begriff des Giftmischers steckt die vollständige Definition unseres Problems. Das Gift ist die Wirksubstanz, es verbirgt sich in einer Mischung verschiedenster Stoffe, die es zunächst unkenntlich machen, es gar aufgrund der vergleichsweise geringen Menge irrelevant erscheinen lassen. Der Detektiv folgt einem Verdacht, und lässt den Mageninhalt beispielsweise auf Spuren von Arsen überprüfen. Hierzu werden die Mengenverhältnisse aller in Frage kommenden Stoffe, also auch dem Arsen, mit denen aus einem gesunden Magen stammenden verglichen.
Wie ein Prisma, das das Licht zerlegt
Wenn man herausfinden will, weshalb das Sonnenlicht bräunt und das Lampenlicht nicht, muss man die Mischung, aus denen beide Lichtarten bestehen, bestimmen. Dies ist durch Zerlegung mittels eines Prismas möglich. Im Ergebnis wird man feststellen, dass das Sonnenlicht einen wesentlich höheren Anteil kurzwelligen UV-Lichtes enthält, das den entsprechenden Effekt auslöst.
Auch unser Ohr ist solch ein Analyseapparat. Es zerlegt das Frequenzgemisch, das ihm geboten wird, in einzelne Bänder und analysiert deren jeweilige Intensität. Hermann von Helmholtz verglich 1862 die Basilarmembran in der Schnecke des Ohres mit den Saiten einer Harfe, deren jede bei Beschallung mit einem komplexen Signal gemäß Ihrer Resonanzfrequenz schwingt und es damit in seine spektralen Anteile zerlegt (Fourier-Analyse). Wenn Sie in ein Klavier hinein singen, wird das Frequenzgemisch Ihrer Stimme zerlegt. Würde man Sensoren an die einzelnen Saiten anschließen und die Schwingungsenergie einer jeden einzelnen messen, bekäme man eine Fourier-Analyse des Signals und könnte so Anteile erkennen, die im Gemisch nicht eindeutig hervortraten.
Dies scheint ein probates Mittel zu sein, um die verdeckten Unterschiede zwischen Verstärkern unterschiedlicher Couleur zu ergründen. Natürlich besteht der Analyseapparat heute nicht aus mechanischen Saiten, sondern aus einem Computer, der allerdings nach wie vor den Algorithmus des Mathematikers Jean Baptiste Fourier verwendet, der eine komplexe periodische Schwingung in ihre Frequenzanteile aufgliedert.
Aus Gründen der Übersichtlichkeit speisen wir den Verstärker zunächst aber nicht mit einem komplexen Signal, sondern mit einem reinen 1-kHz- Sinuston. Der ideale Verstärker sollte am Ausgang nur die Frequenzanteile aufzeigen, die ihm am Eingang zugeführt werden.
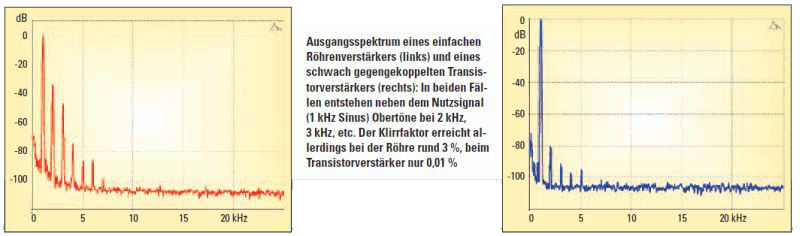
Dies ist, wie man im linken Diagramm erkennt, nicht der Fall. Es handelt sich hier um das Ausgangssignal eines Eintakt- Röhrenverstärkers: Über das 1- kHz-Nutzsignal hinaus produziert er deutliche Oberwellen, also ganzzahlige Vielfache, von 2 bis 6 kHz mit abfallender Stärke. Die Gesamtheit dieser Oberwellen, bezogen auf das Nutzsignal, nennt man den „Klirrfaktor“.
Vergleichen wir dies mit der Messung des schwach gegengekoppelten Transistormoduls (rechtes Diagramm): Die Stärke der Oberwellen ist zwar deutlich geringer, aber ihre Verteilung ist ähnlich. Dies korreliert mit dem klanglichen Eindruck, dass der Transistor bei geringer Gegenkopplung der Röhre recht ähnlich ist. Offenbar spielt die Anordnung der Oberwellen eine wichtigere Rolle als der Gesamtwert des Klirrfaktors.
Wir folgen offenbar der richtigen Spur. Wohin diese uns führt, ergründen wir im nächsten Teil.