Karl Knopf
Klang und Technik
Teil 6: Kompositionstöne
„Man muss messen, was messbar ist und messbar machen, was zunächst nicht messbar ist“ (Gallileo Gallilei)
Diese Forderung Galileo Galileis bezog sich auf die Physik, die Astronomie und die Mathematik, interessanterweise jedoch nicht auf die Erforschung der menschlichen Natur. Die einfachen Empfindungen, so die des Klanges oder der Farbe, sind Grundlage des Denkvermögens, damit aber auch eine Grenze unserer Vorstellungskraft. Galileo Galilei musste sich fragen, wie weit er seine Sinne zur besseren Betrachtung der Planeten schärfen könne, weniger jedoch, welcherlei Aussagen seine Beobachtungen über die Anatomie seines Sehsinnes tätigen und wie diese wiederum sein Denken und damit seine Beobachtungen beeinflussen könnte.
Nähe zum Gefühl
Die Beobachtung des Klanges hingegen vollzieht sich in direkter Nähe zum Gefühl. Das schwingende Objekt an sich ist eindeutig, es lässt sich messtechnisch beschreiben, die subjektive Wirkung kaum, wenngleich ohne diese die technische Beschreibung sinnlos ist. Beobachter und Objekt dienen einander als Maßstab, lassen sich nicht voneinander trennen. Das Experiment hat die Aufgabe, die Perspektive zu verändern – den Zirkelschluss aufbrechen kann es nicht. Teilbereiche werden erhellt, Modellvorstellungen installiert, Klang wird so besser vorstellbar gemacht.
Das Experiment
Wir speisten Verstärker mit einer Sinusfrequenz von 1 kHz und ermittelten die spektralen Anteile selbstproduzierter Töne an einem 4-Ohm-Lastwiderstand, um nicht ob der Produktvielfalt und der Variationsbreite seitens der Lautsprecher eine nicht kalkulierbare Variable in die Messungen einzuführen, die eindeutige Ergebnisse vereiteln würde. Wir stellten fest, dass Verstärker mit einem gleichmäßig abfallenden Obertonspektrum bis zur 6. Harmonischen, deren erste Oberwelle bei 10 Watt Leistung um mindestens 80 dB bedämpft ist, an sehr verschiedenen Lautsprechern gemeinhin ausgewogen und präzise klingen. Röhrenverstärker mit deutlich ausgeprägteren Obertönen sind nicht in gleichem Maße universell einsetzbar, klingen aber gerade an kleinen Lautsprechern sehr gut, da hier das ihnen eigene Klirrspektrum als Hilfsgröße dient, indem es die Erzeugung von Residualtönen beim Hörer unterstützt, welche dem Lautsprecher auf diesem Wege eine virtuelle Größe verleihen, die er physisch nicht hat. Nach dieser Theorie lässt sich ableiten, dass Röhrenverstärker an großen, bassgewaltigen Lautsprechern diesen Vorteil nicht mehr ausspielen dürfen. Das ist auch so. Allerdings hängt dies auch mit dem oft holprigen Impedanzverlauf großer Lautsprecher zusammen, welcher leistungsschwachen Röhrenverstärkern mit geringer Gegenkopplung Schwierigkeiten bereitet. Größere Hornkonstruktionen hingegen sollten aufgrund ihres hohen Wirkungsgrades und eines eher harmlosen Impedanzverlaufes als ernst zu nehmender Maßstab dienlich sein. Wie zu erwarten, ist hier der klangliche Unterschied zwischen Röhre und Transistor bei weitem nicht so ausgeprägt wie an kleinen Lautsprechern. Was zu beweisen war. Wir halten fest: Die ganzzahligen Obertöne eines Verstärkers wirken, wenn sie im richtigen Lautstärkeverhältnis zum Grundton stehen, nicht nur nicht störend, sie sind sogar vorteilhaft, indem sie als Wahrnehmungshilfe dienen, sollten es die Rahmenbedingungen erfordern. Nach wie vor unklar ist allerdings, weshalb Transistorverstärker mit äußerst geringem Klirr müde, kühl oder fad klingen können, wiewohl sie doch eigentlich dem Ingenieursideal entsprechen.
Verstärker rekonstruiert
Die bisherigen Beobachtungen könnten so interpretiert werden, dass genau jenes Fehlen der Oberwellen, welche wir in bestimmten Zusammenhängen als vorteilhaft erachteten, zu einer gewissen klanglichen Lustlosigkeit führt. Ein ernst zu nehmender Hinweis in diese Richtung ist die Tatsache, dass Transistorgeräte mit röhrenähnlichem Klirrspektrum, aber mittlerem bis geringem Klirrfaktor an verschiedensten Lautsprechern einen noch deutlich eindrucksvolleren Klangfarbenreichtum an den Tag legen als sehr klirrarme Konstruktionen. Nehmen wir die komplexe Empfindung des natürlichen Klanges zum Maßstab, bliebe folglich nur, dem Verstärker eine psychoakustische Rekonstruktion des Signals zu unterstellen, welche dann schlüssig ist, wenn ein Verlust an Information auf dem Weg bis dorthin vorausgesetzt wird.
Das Zweikörperproblem
Zunächst sollte jedoch geprüft werden, inwiefern die bisherigen Experimente die Realität angemessen darstellen. Bei unseren Messungen haben wir bisher einzelne Sinustöne eingespeist – was in keinster Weise der Struktur komplexer Musiksignale entspricht. Hätte sich Keppler lediglich auf die Bewegung einzelner Planeten konzentriert und wäre nicht von einer Wechselwirkung mit der Sonne ausgegangen (Zweikörperproblem), wäre es ihm nahezu unmöglich gewesen, seine Theorie des heliozentrischen gegenüber der etablierten Meinung des geozentrischen Weltbildes zu verteidigen. Um zu untersuchen, inwiefern die Töne in einem Verstärker miteinander interagieren, müssen wir eingangsseitig mindestens zwei Frequenzen einspeisen und beobachten, ob sich grundlegend neue Erkenntnisse ergeben (siehe Diagramm).
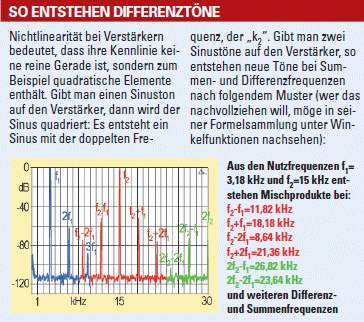
Wir erkennen deutlich, dass
über die eingespeisten Primärfrequenzen
f1 = 3,18 kHz und
f2= 15 kHz und die bereits bekannten
harmonischen Oberwellen
von 2 x f1 = 6,36 kHz und
3 x f1 = 9,54 kHz hinaus noch
weitere Frequenzen aufreten,
welche sich aus den Differenzen
und Summen der Primärtöne
errechnen lassen, weshalb sie als
Differenz-, Summations- oder
allgemein als Kombinationstöne
bezeichnet werden (siehe Kasten).
Die Variationsmöglichkeiten
lassen sich beliebig erweitern.
Mit steigender Ordnungszahl
nimmt die Menge der Einzelfre
quenzen zu, die Amplitude jedoch
umgekehrt proportional
ab, weshalb man ab einem gewissen
Punkt nur noch von einer
Erhöhung des Grundrauschens
sprechen kann, welches
uns hier nicht interessieren soll.
Viel interessanter ist die Frage,
inwiefern die gängige Meinung
Gültigkeit hat, dass Differenztöne,
die in einem komplexen mathematischen
Verhältnis zur
Grundwelle stehen, nicht mit
unserem Harmonieempfinden
korrelieren. Nur zu gerne machen
wir uns dies zu eigen, da
komplizierte Mathematik nicht
unbedingt für Sinnlichkeit steht.
Körnig – kernig?
Hermann von Helmholtz schrieb diesen Tönen eine gewisse Rauigkeit, also eher dissonanten Charakter zu, stellte jedoch gleichermaßen fest, dass sie im Innenohr entstünden, auch wenn sie ihm nicht von außen zugetragen werden, billigte ihnen somit eine natürliche Entstehung zu. Weiterhin könnte man trefflich über das Begriffspaar „Körnigkeit und Kernigkeit“ philosophieren, deren zweiter recht doppeldeutigen Charakter hat. Dies, wie auch die Erkenntnis aus der Kompositionstechnik, dass der Wohlklang konsonanter ganzzahliger Verhältnisse wie der Oktave, Quint, Quart usw. nur dann dauerhaft schön und nicht langweilig erscheint, wenn ihm ein gewisses Maß an Dissonanz unterlegt wird, lässt doch sehr zweifeln, ob einfache Erklärungsmuster hier greifen. Dazu mehr im nächsten Teil.